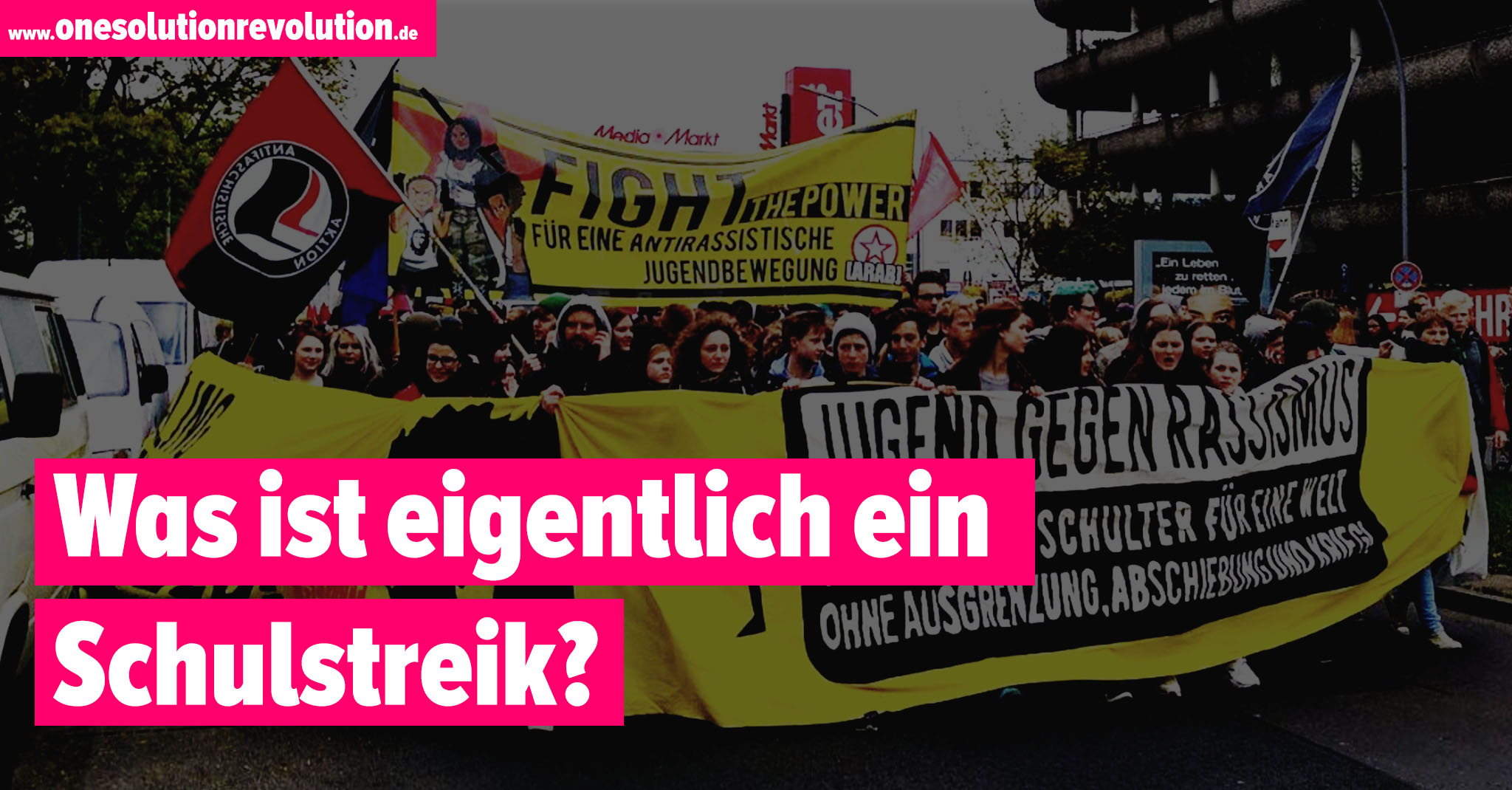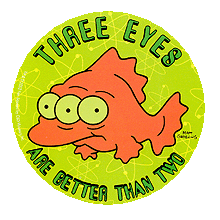1. Gibt es heute überhaupt noch Antisemitismus?
AfD, FPÖ, andere Rechtspopulist_innen und auch viele große Zeitungen sprechen oft davon, dass es einen neuen Antisemitismus in Deutschland gäbe, der durch die vielen Geflüchteten wieder ins Land gekommen sei. Abschiebungsforderungen und antimuslimischer Rassismus sollen getarnt als ein angeblicher Kampf gegen „zugewanderten Antisemitismus“ (Wolfgang Schäuble) salonfähig gemacht und legitimiert werden. Tatsächlich beweisen neuere Studien, dass es einen Anstieg antisemitischer Straftaten gibt. Die Täter waren jedoch in den meisten Fällen nicht Migrant_innen sondern vorwiegend rechte Deutsche. Erinnert sei hierbei 2019 auf den Anschlag in Halle, 2018 an die Angriffe auf ein jüdisches Restaurant in Chemnitz, an die „Wer Deutschland liebt ist Antisemit“-Rufe in Dortmund, als auch an wiederholte Grabschändungen in jüdischen Friedhöfen oder Beleidigungen und Bedrohungen auf offener Straße oder im Internet. Anstatt sich diesen schrecklichen Vorfällen ernsthaft entgegenzustellen, wird Antisemitismus zum Kampfbegriff, um „Integrationsprobleme“ zu beschwören, Entsolidarisierung mit Geflüchteten zu bewirken, Repressionsmaßnahmen wie Abschiebungen zu rechtfertigen und linke Organisationen zu diffamieren. Opfer von rechter Gewalt werden so zu vermeintlichen Täter_innen gemacht. Dadurch wird suggeriert, dass es keinen Antisemitismus mehr gäbe, wenn man sich nur dem Islam, den Geflüchteten und der Palästina-Solidaritäts-Bewegung entledigen würde. In welchem Land der Antisemitismus zum millionenfachen Massenmord an Jüdinnen und Juden führte, dass es in Deutschland niemals ein Ende des Antisemitismus gab und welche ideologischen Kontinuitäten rechte Parteien bis heute davon mittragen, wird somit systematisch verwischt. Keine Rede ist von rechter Esoterik und antisemitischen Verschwörungstheorien, wie der von der „geheimen internationalen Macht jüdischer Großunternehmer wie Soros, den Rothschilds oder Facebook-Gründer Zuckerberg“ oder den angeblichen mächtigen jüdischen Bankiers in den USA, die heimlich das Weltgeschehen steuern. Keine Rede ist von Forderungen aus den Reihen der AfD nach einem „Schlussstrich mit dem Schuldkult“, dem „Denkmal der Schande“, der Forderung wieder „stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen“ (Gauland 2018) oder der Bezeichnung der Nazi-Zeit als einen „Fliegenschiss“ (Gauland 2018) gegenüber der ansonsten so großartigen deutschen Geschichte (die im Übrigen voll von antisemitischen Pogromen ist). Um wieder „stolz auf Deutschland“ sein zu dürfen, wird die historische Schuld abgewehrt, auf andere geschoben (häufig sogar auf die Jüdinnen und Juden selbst) oder die Grausamkeiten des Holocausts verharmlost. Im Fahrwasser eines internationalen Rechtsrucks konnten sich antisemitische Theorien an vielen Orten auf der Welt wieder aus der Mottenkiste befreien. Während die polnische PiS-Partei einen fundamentalistisch-religiös argumentierenden Antisemitismus vertritt, bedient Victor Orbans Fidesz-Partei klassische antisemitische Verschwörungstheorien. Die ukrainische Swoboda-Partei kämpfte im „Euromaidan“ gegen eine von ihnen ausgemachte „jüdisch-russische Mafia“ und verehrt den Nazi-Kollaborateur und Kriegsverbrecher Stephan Bandera. Wo solche Ideologien hinführen, mussten wir im Oktober 2018 in den USA beobachten als ein faschistischer Terrorist in einem schrecklichen Blutbad in einer Synagoge elf Menschen erschoss. Indem der Antisemitismusbegriff jedoch immer weiter allein auf Kritik an der Politik der israelischen Regierung verengt und zum Kampf gegen den Islam und die Palästinasolidarität instrumentalisiert wird, geraten die Lebensrealitäten von in Europa lebenden Jüdinnen und Juden, von Shoa-Überlebenden weltweit und auch antisemitische Übergriffe in der Gesellschaft immer weiter aus dem Fokus. Die eigentliche Gefahr hinter der neuen Welle von Antisemitismus im Zuge des Rechtsruckes und auch der Zusammenhang zwischen deutschem Nationalismus und Antisemitismus werden somit verschleiert. Um dieser Gefahr ins Auge zu sehen und Antisemitismus heute erkennen, erklären und bekämpfen zu können, wollen wir uns im Folgenden erst einmal angucken, was Antisemitismus überhaupt ist, wie er entstanden ist und wie er funktioniert. Ferner wollen wir diskutieren, inwiefern der Staat Israel ein Schutzraum gegenüber Antisemitismus sein kann und was andere Strömungen innerhalb der Linken für Konzepte im Kampf gegen Antisemitismus anzubieten haben. Abschließend zeigen wir auf, wie wir Antisemitismus tatsächlich und nachhaltig bekämpfen können.
2. Was ist Antisemitismus?
Antisemitismus verstehen wir nicht als ein mystisches Schreckgespenst, das durch die Köpfe dummer* Menschen wabert, sondern als eine konkret erklärbare besondere Form des Rassismus, die zu einer historisch singulären Katastrophe führte. Nachdem mit den überseeischen Expansionsbestrebungen des europäischen Kapitalismus eine Legitimation für die Verbrechen der Kolonialist_innen geschaffen werden musste, wurde der moderne Rassismus geboren: Während im Zuge der Aufklärung das Konzept von allgemeinen Menschenrechten in Europa populär wurde, wurden Herrschaftsansprüche über andere Kontinente durch die Idee gerechtfertigt, zu einem „biologisch“ überlegenen „Herrenvolk“ zu gehören. Auf dieser Grundlage wurde eine pseudowissenschaftliche Rassentheorie konstruiert, aus der die europäischen Koloniasor_innen ein natürliches Recht ableiteten, Menschen mit anderer Hautfarbe auszubeuten, zu versklaven und zu ermorden. Rassismus diente und dient auch heute noch also als ideologische Verkleidung für die Ziele imperialistischer Politik: Wo früher das „deutsche Volk“ für „Lebensraum“ oder einen „Platz an der Sonne“ kämpfte, werden heute „westliche Werte“ gegen „andere Kulturkreise“ verteidigt. Antisemitismus diente zwar nicht der Beherrschung und Kolonisation eines Gebietes aber fußt als eine Form des Rassismus auch auf derselben Konstruktion des „weißen Herrenvolkes“. Dessen innere „Gesundheit“ werde durch die Jüdinnen und Juden als „Parasitenvolk“ gefährdet, indem eine „internationale jüdische Finanzmacht“ die „gesunden Nationalstaaten“ unterwandere. Da dies ein heimlich stattfindender geheimer Prozess sei, der nicht aufzuhalten ist und der „Natur des Judentums“ entspreche, fordert der Antisemitismus in letzter Konsequenz immer die „Befreiung der vergifteten Völker“ durch Auslöschung des Judentums. Während beispielsweise der Rassismus gegenüber People of Color von einer Art kulturellen Überlegenheit der „weißen Herrenrasse“ ausgeht, um Überausbeutung und Versklavung zu rechtfertigen, wird im Antisemitismus von einer Bedrohung der „weißen Herrenrasse“ durch angebliche „Weltherrschaftspläne der Jüdinnen und Juden“ ausgegangen. Anti-jüdische Pogrome, Massenmord, Vernichtungsphantasien und Verschwörungstheorien waren und sind die traurigen Konsequenzen dieser Ideologie. Wie jedem Rassismus geht es auch dem Antisemitismus um die Betonung der Differenz zwischen vermeintlichen „Rassen“ (oder „Ethnien“, wie sie nach 1945 bezeichnet wurden). Jüdinnen und Juden werden dabei zu „Fremden“ oder den „Anderen“. So wie es häufig in rassistischen Weltbildern der Fall ist, wurden den Jüdinnen und Juden Eigenschaften angedichtet, die immer genau das Gegenteil von dem darstellen, wie sich „das weiße Herrenvolk“ gerne gesehen hätte. Wenn die Jüdinnen und Juden – also „die Anderen“ – als gierig, hinterlistig, böse, feige, verweiblicht, heimatlos und schwach dargestellt wurden, wollte man damit eigentlich sagen, dass man selber gerecht, ehrlich, gut, männlich, „heimattreu“, loyal und stark sei. Diese Gegenüberstellung ist im Antisemitismus sehr zentral, obwohl sich im Laufe der Zeit und verschiedenen Epochen und Ausprägungen der Feindschaft gegenüber Jüdinnen und Juden verschiedene Formen von Antisemitismus herausgebildet haben. Besonders wichtig ist es hierbei zwischen dem religiös begründeten mittelalterlichen Antisemitismus und dem rassistisch begründeten modernen Antisemitismus, wie er in kapitalistischen Gesellschaften, wie auch dem Faschismus, aufzufinden ist, zu unterscheiden. Im Folgenden werden wir noch viel auf die Entstehung, Ausprägung und Funktionsweise des modernen Antisemitismus eingehen. Kurz und knapp kann man aber an dieser Stelle bereits sagen, dass beim Antisemitismus durch die ökonomische Krisenhaftigkeit des Kapitalismus erzeugte soziale Ängste verschiedener Bevölkerungsgruppen auf Jüdinnen und Juden als Feindbilder projeziert und mit universalistischen Verschwörungs- und Unterwanderungstheorien verknüpft werden. Hass auf Jüdinnen und Juden entsteht also meistens dann, wenn der Kapitalismus das Bedürfnis nach Aufstand und sozialer Veränderung in Teilen des Bürgertums und den verarmten Massen hervorruft und antisemitische Stereotype diesen Wunsch nach kollektivem Aufbegehren auf Jüdinnen und Juden, als die „eigentlichen Strippenzieher hinter dem System“, ablenkt. „Die Juden“ fungieren dabei als ein einheitliches homogenes Kollektiv, was sämtlichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zuwider läuft. Denn da die jüdische Geschichte vor allem eine Geschichte von Vertreibungen, Flucht und Umsiedlungen ist, haben sich in unterschiedlichsten Räumen auf der Welt verschiedene Ausprägungen der jüdischen Religion und jüdischer Identität gebildet. Ob Ashkenazim aus Europa, Sephardim aus Spanien, Mizrachim aus dem muslimischen Raum, Jüdinnen und Juden aus den USA oder kleinere Gemeinden aus Äthiopien und Indien, alle besitzen verschiedene Konzepte ihrer jüdischen Identität, eigene Sprachen, eigene Kultur und eigene Bräuche. Nur eine Minderheit der Jüdinnen und Juden auf der Welt lebt in Israel. Jegliche Theorien von einer gemeinsamen Abstammung, ähnlichen Genen oder einem über alle Grenzen und Zeiten hinweg zusammenhaltenden „Weltjudentum“ sind eine mythische und zugleich rassistische Konstruktion.
3. Wie ist Antisemitismus entstanden?
Natürlich können wir in der über Jahrhunderte hinweg reichenden Geschichte des Antisemitismus hier nicht auf jedes historische Detail eingehen, weshalb die folgende Schilderung vielleicht ein wenig schematisch wirkt. Es geht uns jedoch darum, mit der Methode des historischen Materialismus die allgemeinen sozio-ökonomischen Entwicklungen und geschichtlichen Triebkräfte zu verstehen. Somit wollen wir Antisemitismus als ein gesellschaftliches Produkt mitsamt seiner Produktions- und Reproduktionsbedingungen erfassen. In diesem Sinne hat der jüdische Trotzkist Abraham Leon, welcher 1944 in Auschwitz ermordet wurde, eine sehr gute Studie verfasst, an deren Erkenntnissen wir uns stark orientiert haben: Trotz vielfachen Vertreibungen und Umsiedlungen verhalfen verhältnismäßig (!) sichere Lebensbedingungen dem Judentum der Antike zu kultureller Blüte. Im europäischen Mittelalter wurden die Jüdinnen und Juden jedoch zunehmend in Berufszweige wie Handel, Geldverleih und spezialisiertes Handwerk gedrängt. Durch die Verbote wichtige Ämter auszuüben, Waffen zu tragen, Land zu besitzen und Zünften anzugehören, war der den Christ_innen als sündig geltende Geldverleih eine von wenigen Tätigkeiten, die die Jüdinnen und Juden überhaupt ausführen durften. Der sogenannte mittelalterliche Antisemitismus wurde im Zuge dessen als religiöse Ideologie gebraucht, um den sozialen Ausschluss der Jüdinnen und Juden zu legitimieren. Hier entstanden erste Bilder von Jüdinnen und Juden als den „Christusmördern“, den „Brunnenvergiftern“, „Kindermörder“, „den geizigen Wucherern“, „Ritualmördern“ und sonstige bullshit-Verschwörungstheorien – soviel zum Thema „jüdisch-christliches Abendland“. Diese sozio-ökonomische Sonderstellung, in die die Jüdinnen und Juden im feudalen Mittelalter gedrängt wurden, hat ihre Integration in die bestehende Klassengesellschaft verhindert und gleichzeitig bewirkt, dass die jüdischen Communities relativ isoliert ihre eigene Sprache, Kultur, Religion und Siedlungsgebiete behielten. Gerade in wirtschaftlichen Krisenperioden wurden blutige Pogrome gegen die jüdische Bevölkerung in Europa angestiftet. Zu massenhaften Vertreibungen oder Massenmorden kam es jedoch eher selten, da das feudale Wirtschaftssystem auf die ökonomische Funktion der jüdischen Bevölkerung angewiesen war. Die große Katastrophe begann mit der schleichenden Auflösung des Feudalismus und seiner Ablösung durch ein neues Wirtschaftssystem, den Kapitalismus. Denn indem der Kapitalismus durch seine technologisch-industriellen Entwicklungen eine neue Klasse, das Bürgertum, an die Macht hievte, lösten sich feudale Strukturen wie der Ständestaat, die Herrschaft des Adels oder die Leibeigenschaft nach und nach auf. Auch die sozio-ökonomische Sonderstellung der jüdischen Communities wurde somit nach und nach untergraben. Während sich in Westeuropa der Kapitalismus blühend entwickelte und die jüdische Bevölkerung mehrheitlich Teil der Arbeiter_innenklasse oder des Bürgertums werden konnte, verlief die Entwicklung des Kapitalismus in Osteuropa eher stockend. Die vielen Krisen und die hohe Arbeitslosigkeit behinderten die Jüdinnen und Juden dabei, hier einen neuen Platz im kapitalistischen System zu finden. Dieser Prozess ging mit einer dramatischen Verarmung der jüdischen Communities und wachsendem Antisemitismus in Osteuropa einher. Infolgedessen flohen viele Jüdinnen und Juden nach Westeuropa. Doch auch hier geriet der Kapitalismus insbesondere in den 30ern Jahren in eine tiefe Krise. Die neu entstandene faschistische Bewegung in Deutschland knüpfte am mittelalterlichen Stereotyp der „jüdischen Wucherer“ an und konstruierte die Legende vom „jüdischen Finanzkapital“. Dieses „böse raffende Kapital“ wurde dem „guten deutschen schaffenden Kapital“ gegenüber gestellt. So war es den Faschist_innen möglich, den Frust und die sozialen Abstiegsängste, die kleine Unternehmen, Handwerker_innen, Selbstständige und Arbeiter_innen im Zuge der Wirtschaftskrise erlebten, von den Herrschenden abzulenken und auf die jüdische Bevölkerung zu richten. Die konsequenteste Gegnerin des Faschismus – die internationale Arbeiter_innenbewegung – wurde ebenfalls in das Konstrukt des „jüdischen Feinds“ integriert. Antisemitismus und Antikommunismus eint dabei die Vorstellung, das Judentum und die revolutionäre Arbeiter_innenbewegung seien eine gegen die „gesunden Völker“ gerichtete „jüdisch-bolschewistische Weltverschwörung“, die die als natürlich gewachsen verstandene Ordnung der Nationalstaaten auflösen und die „Volksgemeinschaften“ mit ihrem „Gift“ zersetzen will. Dem herrschenden Bürgertum kam dieses Feindbild im Zuge der Verschärfung der Wirtschaftskrise und einer wachsenden revolutionären Arbeiter_innenbewegung, die ihre Macht zu bedrohen schien, ziemlich gelegen. Der Antisemitismus diente somit seit jeher auch als wirksame Waffe gegen den Marxismus. So wie die internen Probleme, dem „jüdischen inneren Feind“ angelastet wurden, wurde dieser auch auf eine äußere Bedrohung, den „jüdischen Bolschewismus“ projiziert. Nach Hitlers Machtübernahme hatte der Antisemitismus nun die Funktion, verschiedene Klassen ideologisch in einer Rasse aufgehen zu lassen und somit eine „deutsche Volksgemeinschaft“ zu konstruieren, die sich gegen den inneren und äußeren „jüdischen Feind“ verteidigen müsse. Die schreckliche Konsequenz dessen war der industrielle Massenmord an über 6 Millionen Jüdinnen und Juden. Doch auch tausende Jüdinnen und Juden setzten sich gegen den Antisemitismus auf verschiedenste Weisen zur Wehr. Viele erkannten den Zusammenhang von Antisemitismus und Kapitalismus und schlossen sich der kommunistischen Arbeiter_innenbewegung an, um diesen zu überwinden. In der Oktoberrevolution in Russland kämpften zum Beispiel tausende Jüdinnen und Juden siegreich gegen das brutale und antisemitische Regime des Zaren. Dies zeigt uns wie jüdische Arbeiter_innen in den Reihen der Bolschewiki für die Befreiung von Antisemitismus, Ausbeutung und Krieg gegen den Kapitalismus kämpfen konnten. Die darauffolgende stalinistische Degeneration der Sowjetunion hat jedoch den Antisemitismus wieder auf die Tagesordnung geholt, um von inneren Widersprüchen abzulenken und gezielt politische Gegner_innen auszuschalten. Auch zur Verfolgung von Trotzkist_innen wurden antisemitische Stereotype neu aufgewärmt. Die lange Geschichte des europäischen Antisemitismus ist leider auch heute trotz der historischen Katastrophe der Shoa nicht beendet. Wenn gleich nicht mehr offen mit dem Antisemitismus hausiert werden darf, tritt er heute eher verdeckt auf. Vor allem dort, wo nach verkürzten Lösungen für die kapitalistische Krise gesucht wird, ohne den Kapitalismus als Ganzes infrage stellen zu wollen. Besonders anfällig für verkürzte Kapitalismuskritiken sind meistens die Teile der Gesellschaft, die im Allgemeinen vom Kapitalismus profitieren aber in Wirtschaftskrisen vom großen Monopol- und Bankenkapital bedroht werden – also kleine Unternehmen, Selbstständige, Handwerker_innen und Kleinbürger. Doch auch in Teilen der Arbeiter_innenbewegung kann der Antisemitismus durch Niederlagen ihrer Führung fußfassen. Auch heute sind wieder Begriffe wie die „jüdische Zinslobby“ und die „dunkle jüdische Macht im internationalen Bankenwesen“ im Kontext der Auswirkungen der Wirtschaftskrise von 2008 von der Neuen Rechten zu hören. So fordert Marie Le Pens „Ressemblement National“ einen autoritäreren Staaten, der sich gegen den „gierigen Finanzmarkt“ verteidigen könne, damit die „kosmopolitische Wirtschafselite“ nicht die „natürliche Staatenordnung zersetze“. Auch in Deutschland gibt es Stimmen die verlauten, dass die „jüdische Weltverschwörung“ die „internationalen Eliten“ kontrolliere und somit eine „Fremdbestimmung Deutschlands“ anstreben. Auch der völkische Nationalismus der AfD mit seinem Bestreben einen „ethnisch einheitlichen Volkskörper wiederherzustellen“ und seinem Hass auf alles vermeintlich „Fremde“ wird sich in letzter Konsequenz auch gegen Jüdinnen und Juden richten. Getarnt hinter ihrer Solidarität mit Israel gehen bekannte Neonazis und Holocaustleugner in ihren Parteibüros ein und aus.
4. Ist also jede verkürzte Kapitalismuskritik automatisch antisemitisch?
Nein, ist sie nicht. Richtig ist jedoch, dass der moderne Antisemitismus meistens als eine verkürzte Kapitalismuskritik auftritt. Das haben wir bereits historisch an der nationalsozialistischen Legende vom „guten deutschen schaffenden Kapital“ versus „böses jüdisches raffendes Kapital“ oder auch aktuell an den neu-rechten Verschwörungstheorien um den Unternehmer Georges Soros aufgezeigt. Jüdinnen und Juden werden hier mit der abstrakten Seite des Kapitalismus identifiziert und für seine negativen Folgen, wie Finanzkrisen und Kriege, verantwortlich gemacht. Der Kapitalismus wird dabei nicht in seiner Gänze als krisenproduzierendes Ausbeutungsverhältnis zwischen gesellschaftlichen Klassen betrachtet, sondern als ein grundsätzlich funktionierendes und gutes System. Obwohl im aktuellen Entwicklungsstadium des globalisierten Kapitalismus (Imperialismus genannt) die tatsächliche Warenproduktion und die Finanzsphäre untrennbar miteinander verflochten sind, versuchen Antisemit_innen die „Zins- und Finanzwirtschaft“ analytisch abzukoppeln. Der Kapitalismus sei also ein funktionierendes System, wenn da nicht die „gierigen jüdischen Banker_innen“ wären. Dabei projizieren sie geläufige Ansichten gegenüber der Finanzwelt, wie dass sie international, universal, undurchschaubar sowie gierig sei und hinter jedem weltpolitischen Ereignis die Strippen ziehe, auf die Jüdinnen und Juden. Jedoch ist nicht jede Kritik und jedes Aufbegehren gegen das kapitalistische System, automatisch antisemitisch. Einige selbsternannte „Linke“, wie die sogenannten „Antideutschen“, vertreten jedoch diese Ansicht. Ihrer Meinung nach sei jede Form von sozialer Organisierung und Protest auf der Straße etwas Gefährliches, da der Großteil der Bevölkerung nicht die Komplexität der kapitalistischen Warengesellschaft durchschaue und deshalb immer zu einer verkürzten Kapitalismuskritik (synonym dazu auch regressive Kapitalismuskritik, personalisierte Kapitalismuskritik oder struktureller Antisemitismus) neige. Diese verkürzte Kapitalismuskritik richte sich ihrer Meinung nach automatisch in letzter Konsequenz gegen Jüdinnen und Juden und führe zu antisemitischen Vernichtungsphantasien. Organisierter Widerstand auf der Straße ist in ihren Augen kein Instrument zur Befreiung sondern eine Gefahr. Leider macht es das kapitalistische System den Massen tatsächlich schwer, seine Funktionsweise zu durchschauen, deshalb richten spontane Proteste ihre Kritik meistens erst einmal gegen ein bestimmtes Symptom, eine Person oder eine Institution des kapitalistischen Systems ohne bereits das gesamte Kapitalverhältnis verstanden zu haben. Wenn man die Analyse der „Antideutschen“ teilt, dann wären zum Beispiel solche Bewegungen wie kollektive Aktion gegen Massenentlassungen oder Lohnkürzungen in Betrieben, Proteste gegen den Kohlekonzern RWE, Anti-Gipfelproteste, Antigentrifizierungsbewegungen wie „Deutsche Wohnen &Co. enteignen“ oder auch Proteste gegen die europäischen Spardiktate der Trioka wie zum Beispiel „Blockupy“ der pure Antisemitismus. Es stimmt natürlich, dass nicht einzelne Konzerne oder Regierungsvertreter_innen alleine für die Auswirkungen des Kapitalismus verantwortlich gemacht werden können, denn auch sie sind vom strukturellen Zwang des Kapitalismus (= Profit erwirtschaften, um nicht von der Konkurrenz plattgemacht zu werden) betroffen. Und es stimmt auch, dass diese Bewegungen ihre Ziele letztlich nur umsetzen können, wenn sie die Wurzeln der Probleme, gegen die sie protestieren, richtig analysieren und im kapitalistischen Ausbeutungszusammenhang suchen. Es ist aber total falsch zu glauben, dass nur Menschen, die meinen die kapitalistische Produktionsweise verstanden zu haben, ein Recht haben, auf die Straße zu gehen! Wir als Revolutionär_innen müssen uns deshalb in solche Bewegungen einmischen, intervenieren, damit sie nicht bei einer verkürzten Kritik stehen bleiben, und eine antikapitalistische Perspektive aufzeigen (Antisemitismus ist dabei, sollt er auftreten, auf das Schärfste zu bekämpfen), anstatt uns wie die „Antideutschen“ in der Unibibliothek zu verschanzen und nur zu rumzukritisieren.
5. Wenn es heute noch viel Antisemitismus auf der Welt gibt, sind dann der Staat Israel und seine nationale Ideologie des Zionismus die Lösung des Problems?
Der Zionismus ist als eine politische Idee und Nationalbewegung entstanden, um das Problem des modernen Antisemitismus zu lösen. Er greift das antisemitische Paradigma auf, dass die Jüdinnen und Juden in allen bestehenden Staaten ein Fremdkörper seien. Daraus schlussfolgert er, dass die Jüdinnen und Juden einen eigenen jüdischen Nationalstaat errichten müssten. Der Zionismus akzeptiert somit eine antisemitische Welt als Normalzustand und konnte deshalb zwar auf den Antisemitismus reagieren, ihn aber nicht bekämpfen. Den Jüdinnen und Juden versprach er, sie von der ewigen Vertreibung und Verfolgung zu erlösen und ihnen ein sicheres Zuhause zu bieten, das die Jüdinnen und Juden wieder selbst zum Subjekt ihrer Geschichte werden lässt. Der Kapitalismus, der den modernen Antisemitismus selbst erst hervorgebracht hat, sorgte durch seine internationale Entwicklung gleichzeitig dafür, dass der Zionismus seine Versprechen als Reaktion auf den Antisemitismus nie einlösen konnte. Denn in einer Welt, welche Mitte des 20. Jahrhunderts durch den globalisierten Kapitalismus bereits in Nationalstaaten eingeteilt war, können keine wirklich unabhängigen neuen Nationalstaaten mehr entstehen. Ähnliches haben wir auch in den ehemaligen europäischen Kolonien in Afrika, Asien und Südamerika gesehen. Sie können zwar formal politisch unabhängig sein, eine eigene Regierung haben etc. aber werden immer wirtschaftlich von einem stärkeren Staat abhängig sein. Auch die israelische Geschichte hat gezeigt, dass die Entwicklung dieses Staates nur durch die abwechselnde Unterstützung verschiedener Großmächte wie der Sowjetunion, Frankreich oder den USA möglich war. Unabhängigkeit und Sicherheit sehen anders aus, denn die Unterstützung durch eine wirtschaftliche und militärische Großmacht ist dem israelischen Staat auch nur solange gesichert, bis kein profitablerer Partner in der Region auftaucht. Erst recht in der aktuellen Phase in der wir eine Verschärfung um den Kampf um die Neuaufteilung der Welt erleben und sich neue Bündnisse bilden, kann ein heute noch israelfreundlicher Staat schnell bei veränderten internationalen Kräfteverhältnissen antisemitische Züge annehmen, dafür gibt es im Kapitalismus keine Garantie. Ferner ist es eine Illusion zu glauben, dass die Gründung eines neuen Nationalstaates, der auf der Vertreibung der dort ansässigen Bevölkerung – den Palästinenser_innen – beruht, seinen Bewohner_innen ein friedliches Leben garantieren könne. Natürlich haben sich die Palästinenser_innen gegen ihre Vertreibung gewehrt und tun dies auch heute noch, und zwar nicht weil sie so antisemitisch drauf sind und das Leiden der geflohenen Jüdinnen und Juden nicht anerkennen, sondern weil sich niemand gerne vertreiben lässt. Der israelische Staat muss sich also immer bis an die Zähne bewaffnen, um weiter existieren zu können, weshalb die israelische Gesellschaft selbst immer unter Militarismus und Unsicherheit leidet. Auch deshalb wird sie immer von der militärischen Rückendeckung einer anderen Großmacht abhängig sein, welche wiederum dabei ihre eigenen Interessen verfolgt. Immer mehr Israelis haben keinen Bock mehr auf Krieg, Militarisierung und ethno-nationalistischen Rechtsruck in ihrem Geburtsland und zeihen dem ein Leben außerhalb ihres „Schutzraumes“ vor. Seit einigen Jahren bereits wandern mehr Jüdinnen und Juden aus Israel aus, als neue einwandern. Viele davon tun dies aus ökonomischen Gründen. Für Israelis, die sich aus politischen Gründen nicht dem staatlich verordneten Nationalismus unterordnen wollen, war eh schon lange klar, dass sie nicht in einem „jüdischen Schutzraum“ leben. Linke Jüdinnen und Juden (wie von Breaking the Silence, Peace Now, Anarchists against the wall, Militärdienstverweiger_innen, linke Akademiker_innen, Kommunist_innen usw.), die sich gegen diese Zustände wehren, werden in Israel immer stärker gesellschaftlich gebrandmarkt, geächtet und als „Vaterlandsverräter“ und „innere Feinde“ beschimpft. Während also immer mehr Israelis ihrer „nationalen Heimstelle“ den Rücken zukehren, werden in Deutschland aber auch international immer mehr Stimmen laut, die Kritik an der israelischen Politik durch den Vorwurf des Antisemitismus zu delegitimieren versuchen. Wir finden es ziemlich verleumderisch zu behaupten, dass jede Kritik am rassistischen Charakter der israelischen Politik, antisemitisch wäre und „dem jüdischen Volk“ (was auch immer das sein soll; gemeint sind vermutlich alle Jüdinnen und Juden auf der Welt) das Recht auf Selbstbestimmung nehmen würde. Einerseits werden hier alle Jüdinnen und Juden der Welt für die Interessen des israelischen Staates instrumentalisiert und andererseits jüdische Selbstbestimmung auf die Solidarität mit Israel begrenzt. Dementgegen sollte vielmehr die Achtung vor der Vielfalt jüdischer Identitäten und die analytische Trennschärfe von Judentum und israelischem Staat die Grundlage für den Kampf gegen Antisemitismus darstellen. Dabei heißt die kommunistische Kritik am Zionismus, nicht das Selbstbestimmungsrecht der israelischen Arbeiter_innenklasse zu leugnen, sondern es in Verbindung mit der freien und gleichberechtigten Entwicklung der Palästinenser_innen einzufordern! Denn wie Marx schon einmal geschrieben hat: „Ein Volk, das ein anderes unterdrückt, schmiedet sich selbst die Ketten“. Und das sieht man in Israel zum Beispiel daran, dass Armut, Wohnungsmangel, Militarismus, Lebenshaltungskosten und Arbeitsbelastung massiv steigen, da der Staat etliche Millionen in die Besatzung der palästinensischen Gebiete stecken muss. Sozialleistungen werden gekürzt, um den Preis der Besatzung zahlen zu können. Israel ist genauso wie jeder andere kapitalistische Nationalstaat eine Klassengesellschaft, in der die Mehrheit die Arbeiter_innenklasse darstellt. Auch diese wird von den nationalen Kapitalist_innen unterdrückt und ausgebeutet. Die Unterdrückung der Palästinenser_innen dient den Kapitalist_innen als Absatzmarkt, als Reservoir billiger Arbeitskraft und als ideologisches Band, das die Klassengegensätze in Israel durch eine ausländische Bedrohung verwischen soll. Zudem vollzieht die israelische Regierung einen immer stärker werdenden Rechtruck, der sich in einer immer rassistischeren und aggressiveren Besatzungspolitik äußert. Israels rechts-nationalistischer Premierminister Netanjahu scheut in seinem Kampf gegen den „islamischen Terror“ dabei auch nicht davor zurück, sich mit offenen Antisemiten wie Victor Orban oder anderen Rechtspopulist_innen wie Le Pen oder Trump zu verbünden. Netanjahu verzeiht den Neuen Rechten bereitwillig ihren Antisemitismus, solange sie wenigstens überzeugte Zionist_innen sind. Gleichzeitig geht er immer schärfer gegen die kritischen Stimmen innerhalb und außerhalb Israels vor und forderte aus diesem Grund zuletzt sogar die deutsche Regierung auf, ihre finanzielle Unterstützung an das jüdische Museum in Berlin zu beenden. Die deutschen Bundesregierungen spielen sich seit Israels Staatsgründung 1948 als enge Vertraute und Beschützer_innen jüdischen Lebens auf. Um sich nicht mit den Problemen der Jüdinnen und Juden in Deutschland und historischen Kontinuitäten aus dem Faschismus auseinandersetzen zu müssen, konnten deutsche Politiker_innen immer brav auf Israel zeigen. Was uns dabei ideologisch als „Wahrnehmung einer historischen Verantwortung“ verkauft wird, diente letztlich dazu, Deutschlands schlechtes Nazi-Image aufzupolieren und einen ökonomisch und militärisch bedeutsamen Verbündeten in einer geostrategisch wichtigen Region zu haben. Dass Geldzahlungen und Waffenlieferungen als „Wiedergutmachung“ für über 6 millionenfachen Mord bezeichnet werden, ist für uns blanker Hohn! Wer das eigentliche Versprechen des Zionismus nach einem sicheren Zuhause für Jüdinnen und Juden einlösen will, muss eine kommunistische Alternative aufbauen – ob in der Diaspora oder im Nahen Osten! Für die Jüdinnen und Juden in Israel heißt das, gegen die Besatzung, gegen den kapitalistischen Staat und für die Perspektive eines säkularen multi-ethnischen Arbeiter_innenstaates zu kämpfen, in dem jeder Mensch unabhängig von seiner Religion und Hautfarbe in Frieden leben kann. Dafür müssen die israelische und die palästinensische Arbeiter_innenklasse erkennen, dass sie eigentlich dieselben Interessen und Ziele haben und dass sie nur die Ketten des Kapitalismus und Nationalismus davon trennen. Die Geschichte hat schon oft gezeigt, dass nationale Gegensätze im gemeinsamen Kampf für gleiche Ziele verschwinden können. Es wäre sogar rassistisch anzunehmen, dass dies in Israel nicht funktionieren sollte.
6. Aber gibt es nicht auch Kritik am israelischen Staat, die antisemitisch ist?
Es stimmt, dass sich hinter Kritik am israelischen Staat manchmal eine antisemitische Motivation verbirgt. Da nach der Shoa und der deutschen Niederlage im Zweiten Weltkrieg offene Hetze gegen Jüdinnen und Juden zum gesellschaftlichen Tabu geworden ist, versuchen einige Antisemit_innen ihre rassistischen Einstellungen in primitiver Kritik am israelischen Staat zu „tarnen“. Die israelische Besatzungspolitik gegenüber den Palästinenser_innen kommt ihnen da gerade recht, denn so versuchen sie deren Brutalität als etwas explizit „Jüdisches“ darstellen. Dies sehen wir bei faschistischen Neonazi-Organisationen und Parteien wie der NPD oder dem „Dritten Weg“, die in Israel das „Zentrum der zionistischen Netzwerke“ erkennen wollen, von wo aus eine „jüdische Lobby“ ihre dunklen Machenschaften verübe. Israel tritt hier synonym an die Stelle „des Juden“ in den klassischen antisemitischen Verschwörungstheorien. Auch im Islamismus (und teilweise auch im arabischen Nationalismus) taucht häufig ein auf Israel bezogener Weltverschwörungs-Antisemitismus auf, der wie zum Beispiel beim IS auch faschistische Tendenzen annimmt und dringend bekämpft werden muss. In vielen arabischen Ländern hat sich der Antisemitismus heute zur Massenideologie entwickelt, die interne Widersprüche im Interesse der herrschenden Klasse auf Israel als einen „äußeren Feind“ lenkt. Der Islamismus ist in der Region jedoch auch erst als Folge von Kolonialismus und imperialistischen Interventionen (siehe Afghanistan, Irak, Iran, Libanon, …) und Niederlagen der lokalen linken Bewegungen entstanden. Auch die Niederlagen der internationalen linken Kräfte trägt eine Mitschuld daran, da sie es nicht geschafft haben, ihre Antikriegspositionen durchzusetzen. Für die regionale Bevölkerung, die keinen Bock mehr auf ausländische Militärinterventionen hatte, erschien der Islamismus als glaubhaftester und konsequentester Widerstand dagegen. Der Islamismus ist also ein Produkt der imperialistischen Interventionen in der Region und des Fehlens einer kommunistischen emanzipatorischen Perspektive. Wer den Islamismus und den damit einhergehenden Antisemitismus bekämpfen will, muss also den berechtigten Widerstand gegen Besatzung und Fremdherrschaft im Nahen Osten unterstützen, eine kommunistische Perspektive aufzeigen und antisemitische Lügen entlarven. Antisemitische Ideen können unter Menschen, die in arabischen Staaten wohnen oder aus ihnen geflohen sind, verbreitet sein, sind aber nichts genuin Arabisches oder Muslimisches sondern kommen eigentlich aus Europa. Auch eine häufig biographisch begründete Gegnerschaft zur israelischen Politik ist nicht per se antisemitisch. Ob Kritik am israelischen Staat oder auch antizionistische Positionen antisemitisch sind oder nicht, lässt sich häufig an der Stoßrichtung der Kritik erkennen. Wird der Staat Israel mit den Jüdinnen und Juden im Allgemeinen gleichgesetzt sprechen wir von Antisemitismus. Er herrscht dann vor, wenn der Staat Israel als ein Ausdruck des verborgenen Interesses der „jüdischen Macht“ gesehen wird oder mit der „Finanzlobby“ in Verbindung gebracht wird. Antisemitisch ist auch die abstruse Vorstellung, die US-amerikanische Außenpolitik im Nahen Osten werde von einer jüdischen Lobby gesteuert. Es handelt sich ebenfalls um Antisemitismus, wenn die Verbrechen der Nazis mit der Behauptung verharmlost werden, dass der israelische Staat dieselben Methoden verwende. Der aktuell bei „Antideutschen“ und Rechtspopulisten im Trend liegende „3-D-Test“ erklärt jedoch nahezu jede Kritik an israelischer Politik für Antisemitismus. Der von einem rechts-konservativen israelischen Likud-Abgeordneten entwickelte Test definiert den antisemitischen Gehalt von Kritik an israelischer Politik anhand der 3 Kategorien Dämonisierung, Doppelstandards und Delegitimierung (vgl. Natan Scharanski 2003). Demnach sei die auch in der israelischen Linken gängige Bezeichnung Israels als Apartheitsstaat, seine Entstehung als Kolonialismus und auch die Infragestellung seiner Form als Nationalstaat zutiefst antisemitisch. Ebenfalls gilt es als antisemitischer Doppelstandard, wenn sich Kritik allein auf Israel bezieht, ohne die zehntausend Verbrechen anderer Staaten auf der Welt mit einzubeziehen. Dass diese Antisemitismusdefinition von einem rechten israelischen Politiker entwickelt wurde, ist kein Zufall. Immer aggressiver verwendet die israelische Rechte dieses Antisemitismuskonzept als Kampfbegriff, mit dem alle Gegner_innen ihrer Politik (ob Israeli, Palästinenser_in, die BDS-Bewegung, „Jewish Voice for Peace“, Menschenrechtsorganisationen oder linke Parteien und Organisationen) als Antisemit_innen gebrandmarkt werden. Anklang findet sie bei allen, die sich Vorteile von der aggressiven Politik der israelischen Rechten und einer Bekämpfung ihrer Gegner_innen versprechen, von Trump über die britischen Conservatives bis zur AfD. Ein solcher Antisemitismusbegriff, der sich allein auf Kritik an Israel beschränkt und dabei auch noch jede berechtigte Kritik als antisemitisch definiert, verkommt zur ideologischen Waffe einer geopolitischen Neuordnung des „Nahen Ostens“ und macht sich für die neue Rechte anschlussfähig. Tatsächliche Antisemit_innen werden nur zu einem Puzzleteil des „antisemitischen Konsens“ und dadurch unsichtbar gemacht. Ebenso legt die Behauptung, wer den israelischen Staat kritisiere meine eigentlich „die Juden“ eine Gleichsetzung von Israel und Judentum nahe. Dies war und ist wiederum das klassische Futter für antisemitische Verschwörungstheorien. Ferner scheinen die Diskriminierungserfahrungen von Jüdinnen und Juden, die nicht in Israel leben, sowieso kaum jemanden zu interessieren.
7. Wie analysieren andere Strömungen der Linken das Problem Antisemitismus und wie wollen sie ihn bekämpfen?
Bei unserer Recherche ist uns erst einmal aufgefallen, dass die meisten Strömungen innerhalb der deutschsprachigen Linken kein systematisches, wissenschaftliches und historisches Konzept davon haben, was Antisemitismus ist, wie er entstanden ist und wie man ihn bekämpfen kann. Stalinistische und maoistische Organisationen zum Beispiel verstehen Antisemitismus (insofern sie ihn überhaupt thematisieren) als einen sogenannten „Nebenwiderspruch“. Sie erkennen nicht seine dem Kapitalismus inhärenten materiellen Grundlagen sondern betrachten ihn lediglich als eine Manipulationsideologie der Herrschenden. Ihrer Ansicht nach gibt es im Kapitalismus lediglich einen Hauptwiderspruch, nämlich die Unversöhnlichkeit der Interessen von Kapitalist_innen und Arbeiter_innen. Alle anderen Unterdrückungsformen wie Sexismus, LGBTIA-Feindlichkeit und Rassismus stellen untergeordnete Nebenwidersprüche dar und müssten demnach nicht gesondert erwähnt oder gar bekämpft werden. Stalinist_innen gehen folglich davon aus, dass sich das mit dem Antisemitismus schon von selber erledigt, wenn wir nur den Hauptwiderspruch aufgelöst und den Kapitalismus abgeschafft haben. Das Beispiel vom ansteigenden Antisemitismus in der Sowjetunion unter Stalin zeigt uns, wie gefährlich diese falsche Analyse ist. Wer sich hingegen ernsthafter mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt, sind die in diesem Text schon häufiger erwähnten „Antideutschen“. An dieser Stelle wollen wir jedoch klar machen, dass wir sogenannte „Antideutsche“, die die AfD als „einzige Stimme der Restvernunft im deutschen Bundestag“ (Thomas Maul, Autor der Zeitungen Jungle World und Bahamas) betrachten und imperialistische Kriegseinsätze befürworten, nicht als Teil der Linken ansehen. Dennoch konnte sich der Antisemitismusbegriff der „Antideutschen“ in Teilen des antinationalen Spektrums, in Teilen der Linkspartei und in einigen Antifa-Gruppen etablieren. Der grundliegende Fehler in der Analyse der „Antideutschen“ ist, dass sie kein historisch-materialistisches Verständnis davon haben, wie Antisemitismus entstanden ist und wie er funktioniert. Es ist ihnen demzufolge auch nicht ganz klar, was sie dem Antisemitismus eigentlich entgegnen können. Diese Hunde bellen zwar laut aber sie beißen nicht. Im vorangegangenen Text haben wir versucht wissenschaftlich aufzuzeigen, wie sich Kapitalismus und Antisemitismus gegenseitig bedingen und werden im Folgenden Wege zu seiner Bekämpfung vorschlagen. Für die „Antideutschen“ ist der Antisemitismus jedoch bloß ein böses Schreckgespenst, ein dunkler irrationaler Judenhass, der um den Globus wabert und die Menschen willkürlich mit seinem Vernichtungswillen infiziert. Insbesondere Deutsche und Menschen mit muslimischen Glauben seien dabei quasi biologisch anfällig dafür, antisemitisch zu sein. Anstatt seine sozio-ökonomischen Grundlagen zu analysieren, mystifizieren und naturalisieren „Antideutsche“ den Antisemitismus. In Anlehnung an Theodor W .Adornos Theorie des „autoritären Charakters“ haben ihrer Meinung nach Antisemitismus und der gesamte Faschismus kaum etwas mit materiellen Verhältnissen und sozialen Strukturen zu tun sondern sind eine bloße Folge eines falschen Bewusstseins, von Verblendung und mangelnder Bildung. Ihre Antwort ist demzufolge Kritik und Aufklärung. Wir sind uns da nicht ganz sicher, ob alle Antisemit_innen ihrer Einladung ins Uniseminar folgen werden. Neben der Tatsache, dass „Antideutsche“ mit ihrer sogenannten „Ideologiekritik“ Antisemitismus nie werden aufhalten können, führt ihre falsche Analyse dazu, dass sie sich sogar freiwillig auf die Seite des Kapitalismus schlagen. Sie verteidigen ein Ausbeutungssystem, das selbst die eigentliche Ursache für Antisemitismus darstellt. Nachdem der Faschismus in Europa gewütet hat und die Sowjetunion degeneriert und dann zerfallen ist, war für diese Strömung klar, dass die Arbeiter_innenklasse keine Befreiung mehr bringen könne und der Traum von einer besseren Welt zerplatzt sei. Aus diesem Gefühl der Ohnmacht und der Angst eigene Privilegien zu verlieren schlussfolgern sie, dass das Maximum an gesellschaftlicher Entwicklung bereits erreicht sei: Wenigstens sind wir Hitler los, die Unibibliothek ist beheizt und der Nebenjob bei der Bildzeitung ist sicher. Ihre Hingabe an den Kapitalismus führt auch dazu, dass sie jeden organisierten Protest gegen dieses System verachten und als verkürzte und damit antisemitische Kapitalismuskritik diffamieren. Sie gehen dabei von der falschen Annahme aus, zwischen Faschismus und Kapitalismus existiere ein Bruch, der es erfordere, die als „normal“ verstandene „demokratische kapitalistische Zivilisation“ gegen die „Barbarei“ zu verteidigen. Dabei erkennen sie nicht, dass die Barbarei ihre Ursachen letztlich im Kapitalismus hat. Faschismus ist für sie eine Meinung und nicht die totalitärste und brutalste Form kapitalistischer Herrschaft, die nur verhindert werden kann, wenn man den Kapitalismus gänzlich abschafft. In der Konsequenz führt ihre Sympathie für den Kapitalismus dazu, dass sie imperialistische Kriege wie die US-amerikanische Invasion des Iraks oder Buschs „war on terror“ füreine super Sachen halten. Einige forderten vor kurzem sogar, man solle den Iran bombardieren. Den israelischen Staat betrachten sie gemäß dieses Weltbildes als Schutzraum für Jüdinnen und Juden vor dem globalisierten antisemitischen Vernichtungswillen und als Bastion des kapitalistischen Fortschritts inmitten der „muslimischen Barbarei“. Hierzulande geht es den „Antideutschen“ darum, sich bedingungslos und unkritisch mit diesem Staat zu solidarisieren und ihn gegen die geheime Weltverschwörung der Islamisten im Schulterschluss mit der BDS-Bewegung und der antiimperialistischen Linken in den Kommentarspalten von Facebook zu verteidigen. Durch ihre Absage an Klassentheorie und marxistische Geschichtsphilosophie erkennen sie auch keine internen Klassenwidersprüche im israelischen Staat und demzufolge auch keine Perspektive für Emanzipation. Linke und antizionistische Jüdinnen und Juden betrachten sie demzufolge als „Marionetten der Antisemiten“ und als „selbsthassende Juden“. Wir empfinden dies als einen sehr fragwürdigen Paternalismus und finden es sehr bedenklich, wenn Deutsche wieder anfangen zu definieren, wer hier die „wahren Juden“ sind. Indem sich die meistens männlichen, weißen und aus gutverdienen Familien stammenden „Antideutschen“ mit ihren „wahren Juden“ identifizieren, versuchen sie die potentielle Schuld ihrer Nazi-Großeltern abzuwehren. Ähnlich wie es Antisemit_innen in umgedrehter Weise tun, abstrahieren auch die „Antideutschen“ vom konkreten Dasein „realer“ Jüdinnen und Juden und machen sie Projektionsfläche für ihre eigenen Widersprüche. Ihrem Unwillen und ihrer Unkenntnis darüber, wie die materiellen Verhältnisse denen der Antisemitismus entspringt bekämpft werden können, tun sie damit genüge, dass es tausende Kilometer entfernt ja einen israelischen Staat gibt, der für sie den „Kampf gegen Antisemitismus“ mit deutschen Waffen ausfechtet. Ihre deutschen Blitzkriegphantasieen projizieren sie so auf israelische Merkava-Panzer und deutsche Atom-U-Boote. Ihr nicht enden wollender Eifer in der Bekämpfung von pro-palästinensischer Solidarität und israelischen Linken, ihre grundlegend positive Haltung gegenüber dem Kapitalismus und ihre Unterstützung der militärischen und ökonomischen Interventionen der Bundesregierung und der Trump-Administration in „Nahost“ lassen die sogenannten „Antideutschen“ als letztlich ziemlich deutsch erscheinen. Auch in ihrem Engagement gegen die „Islamisierung“ und ihrem antimuslimischen Rassismus stehen sie der AfD wenig nach. Die grundlegend notwendige Absicht, ein zweites Auschwitz für immer verhindern zu wollen, gerät durch einen vollkommen ahistorischen, mystifizierten und auf Solidarität mit einem kapitalistischen Nationalstaat verengten Antisemitismusbegriff weit in den Hintergrund.
8. Wie können wir Antisemitismus bekämpfen?
Mit Analysen wie dieser hier, mit Aufklärungsprogrammen, kritischen Blogs, persönlichen Diskussionen und Bildungsarbeit ist schon einiges getan, um mehr Bewusstsein, Wissen und Awareness gegenüber Antisemitismus in unserer Gesellschaft zu schaffen. Wie dieser Text aber gezeigt hat, ist Antisemitismus nicht ausschließlich ein Problem des falschen Weltbildes oder mangelnder Reflexion. Wir haben erläutert, wie Antisemitismus immer ein Produkt von sozialen Strukturen, die sich aus Veränderungen in der ökonomischen Grundbeschaffenheit einer Gesellschaft ergeben, ist. Der moderne Antisemitismus ist ein Produkt der kapitalistischen Produktionsweise. Radikal gegen Antisemitismus zu sein, bedeutet auch radikal antikapitalistisch zu sein, denn radikal heißt, das Problem an der Wurzel anzupacken. Während in Zeiten des wirtschaftlichen Wachstums Antisemitismus eher selten offen zu Tage tritt, zeigt er seine wahre Fratze in Krisenperioden. Denn wenn die Profite global einbrechen, steigt die Konkurrenz zwischen den einzelnen nationalen Kapitalfraktionen untereinander. Doch wenn kapitalistische Nationalstaaten nach außen hin aggressiver agieren wollen, müssen sie nach innen härter durchgreifen und die Bevölkerung auf einen Feind einschwören. In diesen Situationen können dann Rechte mit ihrer rassistischen Hetze, antikommunistischen Drohungen und antisemitischen Verschwörungstheorien aus ihren Löchern kriechen und sich im politischen Diskurs breit machen. Das Kleinbürgertum und desillusionierte Arbeiter_innen werden von den kapitalistischen Krisen am härtesten getroffen und werden von sozialen Ängsten angetrieben. Wenn es dann kein Programm gibt, das diesen Menschen eine radikale, antikapitalistische, kommunistische Alternative aufzeigt, werden sie zu verkürzten und mitunter antisemitischen Erklärungen für ihre eigene beschissene Lebenssituation greifen und einen Sündenbock suchen. Die aktuelle Zunahme von antisemitischen Gewalttaten und verschwörungstheoretischem Blödsinn ist auch eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise 2007/2008 und den damit einhergehenden Rechtsruck in vielen Ländern auf der Welt. Wichtigster Punkt auf der Agenda der neuen Rechten ist der Hass auf Geflüchtete und den Islam. Parteien wie die AfD haben deshalb große Sympathien für den israelischen Staat, den sie als westliche Bastion gegen den Islamismus betrachten. In diesem Sinne versuchen sie sich nun als „einzige Schutzmacht jüdischen Lebens“ (Weidel 2017) öffentlich darzustellen. Doch Antisemitismus interessiert die Rechtspopulist_innen nur, wenn er von Muslimen kommt und die vielen Antisemit_innen und Holocaust-Relativierungen in ihren eigenen Reihen werden gekonnt ignoriert. Wie sich der Hass auf Migrant_innen und Antisemitismus in einem nächsten Schritt verbinden können zeigen die Verschwörungstheorien über Goerge Soros, dem als Unternehmer jüdischer Herkunft die Steuerung und Finanzierung der Migrationsströme nach Europa vorgeworfen wird. Unterstützung findet diese antisemitische Theorie nicht nur in der ungarischen Regierung sondern auch in Teilen der österreichischen FPÖ, der britischen UKIP, der italienischen Lega Nord, der deutschen AfD und der US-amerikanischen Republikaner. Wenn wir heute gegen Antisemitismus kämpfen, müssen wir uns deshalb zu aller erst dem Rechtsruck entgegenstellen. Und damit sind nicht nur die AfD und die Identitären gemeint sondern auch die staatliche Abschiebepolitik und Aufrüstungsrhetorik (Merkel: „Deutschland muss wieder mehr Verantwortung übernehmen.“) steht für einen wachsenden deutschen Nationalismus. Antisemitismus zu bekämpfen bedeutet hier vor Ort also auch dem Nationalismus seine Grundlage zu entziehen und das deutsche Kapital als unseren größten Feind zu betrachten. Dafür brauchen wir ein antikapitalistisches Programm, das uns Jugendlichen einen Weg aufzeigt, wie wir unseren Kampf gegen Rassismus, Rechtsruck und Nationalismus zu einem Kampf für eine befreite Gesellschaft ausweiten können. Um die kapitalistische Produktionsweise durch eine neue ersetzen zu können, gilt es dabei die Arbeiter_innenklasse für unsere Ziele zu gewinnen, denn diese sitzt durch ihre ökonomische Stellung dort, wo es den Kapitalist_innen am meisten weh tut. Antisemitischen Vorurteilen und Stereotypen müssen wir dabei, wo immer sie uns begegnen, auf schärfste entgegenarbeiten. Denn der Kampf gegen Antisemitismus ist wie der Kampf gegen jegliche andere Unterdrückungsformen wie Sexismus, Rassismus und LGBTIA-Feindlichkeit ein notwendiger und integraler Bestandteil des Kampfes gegen den Kapitalismus als Ganzes. Wenn wir uns nicht gegen Antisemitismus organisieren, werden wir den Kapitalismus nicht abschaffen können und andersherum wird Antisemitismus immer weiter existieren, solange ihn die kapitalistische Produktionsweise anfeuert. Im Rahmen dessen müssen wir im Hier und Jetzt Forderungen aufstellen, die Antisemitismus entgegenwirken und die Widersprüche mit dem Kapitalismus zuspitzen. Dazu gehört die Verteidigung des Rechts auf die freie Ausübung von Religion und Kultur. Ebenso müssen wir das Recht auf Schutz gegenüber Angriffen auf jüdische Einrichtungen und Privatpersonen einfordern und antirassistische Selbstverteidigungsstrukturen organisieren. Trotzdem müssen wir dafür sorgen, dass auch Fluchtwege stets offen bleiben, damit Menschen, die flüchten müssen, woanders Schutz finden können. Die Forderung nach offenen Grenzen ist deshalb zentral im Kampf gegen Antisemitismus und eine wichtige Antwort auf die Fragen, die globale Migrationsströme heute aufwerfen. Wie wir schon gezeigt haben, kann jedoch auch kein kapitalistischer Nationalstaat vollständigen Schutz gegenüber Antisemitismus gewähren (auch nicht der Nationalstaat Israel), weshalb wir diese Forderung immer mit der Perspektive der Aufhebung von Kapitalismus und Nationalstaatlichkeit verbinden müssen. In Israel müssen wir deshalb für die Beendigung der Besatzung, das Rückkehrrecht aller Geflüchteter und eine kommunistische Lösung des israelisch-palästinensischen Konfliktes eintreten, damit die dort ansässige Bevölkerung Ruhe und Frieden finden kann. Lasst uns den rechten Pseudokämpfen gegen Antisemitismus – ob von AfD oder „Antideutschen“ – eine revolutionäre antikapitalistische Perspektive auf der Grundlage einer marxistischen Analyse entgegensetzen, damit sich die Shoa niemals wiederholt!